Bis heute wird der Genozid an den Armeniern geleugnet, weil er nicht in das eigene Weltbild paßt.
Genau darum geht es aber. Es geht um die Konstruktion der Wirklichkeit. Dazu mache ich mir ein Bild. Was nicht reinpaßt ist nicht auf der Welt und in der Wirklichkeit?
Als Armin T. Wegner im Ersten Weltkrieg als Sanitätssoldat im Osmanischen Reich unterwegs war fotografierte er.
Damals wußte er noch nicht, daß er heute (2016) in dem Buch von Gerhard Paul über Das visuelle Zeitalter beim Thema Kriegsbilder im Ersten Weltkrieg auftauchen würde als Beispiel für „politisch unkorrekte Bilder“ die unwiderlegbar „Zeuge eben dieser Gewalt“ waren.
Ohne Armin T. Wegner wäre der Genozid nicht so dokumentiert worden.
Ohne die Fotografie hätte Armin T. Wegner den Genozid so nicht dokumentieren können.
Und zugleich wird hier die historische Dimension des Ganzen deutlich.
Wegner schrieb Fotogeschichte, weil er mit dem Mittel der Fotografie Belege machte, die Ereignisse dokumentieren, welche sonst nicht mehr da wären.
Sogar mehr als hundert Jahre danach werden diese unwiderlegbaren Beweise ignoriert.
Hier gelten Fotos noch als authentisch.
Authentizität ist das Kriterium von Dokumentarfotografie.
Armin T. Wegner hat dazu damals mit seinen Fotos selbst einen Lichtbildvortrag ausgearbeitet.
Gerhard Paul weist darauf hin, daß im Ersten Weltkrieg die Fotografie durch die Soldaten und die Zivilisten eine völlig neue Dimension erhielt.
„Sie pluralisierten und demokratisierten das bisherige Kriegsbild.“(94)
Genau darum geht es ja bei der Konstrukion der Welt im Kopf. Die Bilder im Kopf konstruieren die Welt.
Und die Bilder im Kopf konstruieren auch die Welt des Krieges.
Aber es gab und gibt ja nicht nur Menschen wie Armin T. Wegner, die Fotos machten, welche dokumentieren und anklagen sollten.
Licht hat auch Schatten.
Darauf weist Gerhard Paul hin:
„Ein neues Phänomen, das sich durch die gesamte Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts bis hin in die Folterkeller von Abu Ghraib ziehen sollte, war das geradezu manische Fotografieren an Orten des Sterbens. Fotografieren war dabei nicht länger nur ein dokumentarischer Akt, sondern eine Lust an der Gewalt, eine virtuelle Form des Mitschießens und damit ein Akt der Beteiligung an der Gewalt.“
Das ist neu und zeigt, daß man sehr genau zwischen Funktionen und sozialen Gebrauchsweisen unterscheiden muß.
Daher ist das fotografische Festhalten des Völkermordes an den Armeniern eines der ersten Beispiele für visuelle Zeugenschaft, die als Beweis in die Geschichtsschreibung einging.
Sie wird zwar von den Mächtigen bis heute z.T. geleugnet, ist aber durch die Möglichkeit, sogar digital verbreitet zu werden, in ihrem Wahrheitsgehalt nicht aufzuhalten.
Bemerkenswert ist auch, daß heute – 2016 – die Grünen im Bundestag einen Antrag aus Rücksicht auf die Türkei zurückziehen, in dem dezidiert an den Völkermord erinnert werden sollte. Später wurde der Antrag dann doch wieder auf die Tagesordnung gesetzt und nun passierte etwas, das seinesgleichen sucht; die Regierung floh. Merkel und Steinmeier fehlten ebenso wie andere und Erdogan drohte, wenn die Erklärung angenommen würde, dann … Und im Ergebnis erhalten nun einige MdB´s Morddrohungen, weil die Resolution fast einstimmig angenommen wurde.
Man kann keinen Haftbefehl gegen die Wahrheit ausstellen, der auf Dauer wirkt. Insofern ist dies hier ein Musterbeispiel für die dokumentarische Funktion der Fotografie und den Mut, die Wahheit zu sagen. Davon lebt unsere Demokratie.


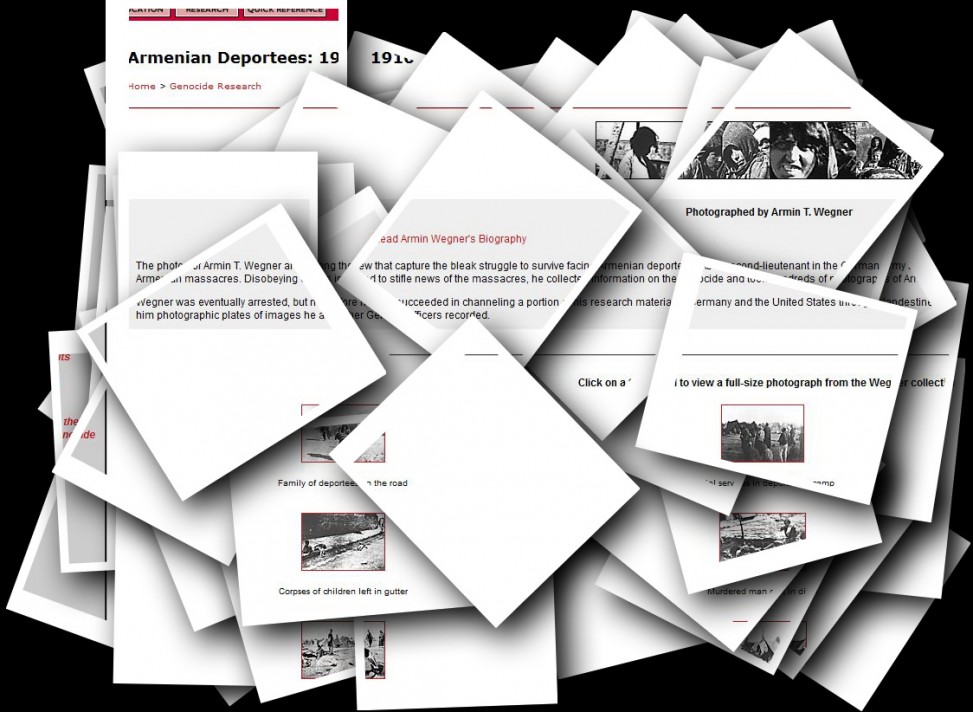
bruno neurath-wilson
Vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag. Habe gerade „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ von Franz Werfel gelesen und stieß anlässlich meiner Recherchen zu diesem Thema auf diese Webseite, die für mich – auch über dieses Thema hinaus – voller Anregungen steckt!!